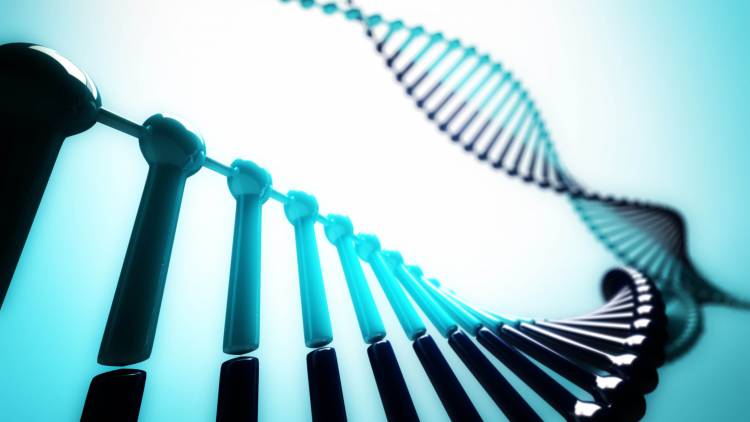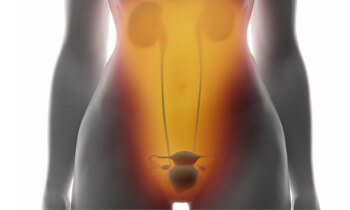Ziel der Studie war es herauszufinden, ob einige der natürlich vorkommenden Varianten von Genen bei Parkinson-Patienten häufiger vorkommen als bei gesunden Personen. Die Basis der Studie bildeten sieben Millionen genetische Variationen auf dem gesamten menschlichen Chromosomensatz. Dafür untersuchten die Forscher DNA-Proben von 19.061 Parkinson-Patienten und 100.833 gesunden Personen europäischer Abstammung. Dabei wurde für jeden Probanden ein individuelles Risikoprofil erstellt. „Obwohl die Wirkung jedes einzelnen Gens gering war, zeigte unsere Risikoprofil-Analyse, dass ein wesentliches kumulatives Risiko besteht“, berichtet Claudia Schulte vom Hertie-Institut für klinische Hirnforschung (HIH) der Universität Tübingen und dem Tübinger Standort des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE).
Besserer Einblick in Entstehung der Krankheit
Die Ergebnisse zeigen, dass sich das Risiko an Parkinson zu erkranken bis auf ein Dreifaches erhöhen kann, wenn dementsprechende ungünstige Genvarianten in der DNA eines Menschen vorhanden sind. Die Identifizierung dieser ungünstigen Varianten gewährt einen besseren Einblick in die molekulare Entstehung der Krankheit und könnte zur Entwicklung neuer Therapiestrategien führen. Ein einzelnes Risikogen reicht jedoch nicht aus, um die Erkrankung definitiv vorherzusagen, so Schulte. Weitere Faktoren wie Umwelteinflüsse (Pestizide oder Schwermetalle) sowie familiär vererbte Mutationen müssen hierfür berücksichtigt und noch weiter erforscht werden.Ebenfalls wurde untersucht, ob die spezifische Zusammensetzung der entdeckten genetischen Risikofaktoren bei Parkinson-Patienten auch Auswirkungen auf den Krankheitsverlauf hat. „Gelingt es uns, diese Zusammenhänge zu klären, kommen wir damit einer individuellen personalisierten Parkinson-Therapie ein Stück näher“, hofft Schulte.
Von den Erkenntnissen profitieren nicht nur die Autoren der Studie. Die gewonnenen Daten sind auch für alle anderen Forscher in einer Datenbank (dbGAP) zugänglich.
Zur Studie